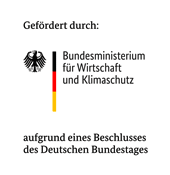Als Exportnation ist Deutschland auf einen sicheren und umweltfreundlichen Seeverkehr angewiesen – rund 90 % des Welthandels laufen über die Schifffahrt. Der maritime Sektor hat daher große wirtschaftliche Bedeutung. Die maritime Sicherheit – in Bezug auf Betriebssicherheit (Safety) und Gefahrenabwehr (Security) – spielt eine zentrale Rolle. Neue digitale Technologien und Echtzeitinformationen bieten Chancen zur Verbesserung der Sicherheit. Angesichts geopolitischer Entwicklungen steigt der Bedarf an Schutz kritischer Infrastrukturen. Dafür werden gezielt Fördermittel für Forschung zu „Echtzeittechnologien für die Maritime Sicherheit“ bereitgestellt.
Förderziel, Zuwendungszweck und Rechtsgrundlagen
Gefördert wird die Entwicklung innovativer Echtzeittechnologien zur Verbesserung der maritimen Sicherheit (Safety & Security). Im Fokus stehen Kooperationen zwischen Wirtschaft und Forschung. Ziel ist es, Synergien zu schaffen und neue Geschäftsfelder – insbesondere für IT-Unternehmen – zu erschließen. Dabei wird ein breites Anwendungsspektrum im maritimen Bereich adressiert.
Zu den bedeutendsten Anwendungen gehören unter anderem:
• Schutz maritimer Infrastrukturen und der dort beschäftigten Menschen
• Überwachung maritimer Gebiete zur Prävention illegaler Aktivitäten
• Schutz und Sicherung der globalen Versorgungskette
• Sicherheit der maritimen Transportsysteme sowie der Seefahrer und Passagiere
• Mariner Umweltschutz durch Beobachtung und Vermeidung von Unfällen
Echtzeitfähige maritime Sicherheitssysteme können einen Beitrag dazu leisten, frühzeitig Bedrohungen zu erkennen und sollen den Nutzer – auch über große Entfernungen hinweg – in die Lage versetzen, anhand von möglichst um fassenden Informationen kontext- und situationsbezogen Entscheidungen zu treffen. Eine zeitnahe Aufbereitung und ggf. intelligente Reduktion des anfallenden Datenstroms für die sinnvolle Visualisierung und Präsentation von Informationen ist dazu erforderlich.
Auch im Bereich der e-Navigation, der Erstellung und Interpretation von Lagebildern, der Entwicklung von Assistenzsystemen für eine zukünftige (teil-)autonome Schifffahrt und von Navigationslösungen zur effizienten und sicheren Routenführung sollen innovative Technologien entwickelt werden.
Gegenstand der Förderung
Gefördert werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit hohem wissenschaftlich-technischem Risiko im Bereich Echtzeittechnologien für die maritime Sicherheit. Ziel ist die Bereitstellung sicherheitsrelevanter Informationen in Echtzeit sowie die Entwicklung sicherer Kommunikationssysteme, vernetzter Infrastrukturen und interoperabler Sicherheitsdienste. Auch Innovationscluster können unterstützt werden.
• Beobachtung von Seegebieten und der dortigen Infrastruktur
• Multisensorielle Datenfusion und integrierte Lagebilderstellung
• Dienstbasierte Assistenzsysteme und integrierte Verkehrs- und Transportleitung
• Online-Zustandsüberwachung bei Schiffen und maritimen Strukturen zur Fernwartung und Intervention
Zuwendungsempfänger
Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einer Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland. Anträge von kleinen und mittleren Unternehmen2 (KMU) sowie Start-ups sind ausdrücklich erwünscht.
Antragsberechtigt sind auch Einrichtungen der Kommunen und Länder sowie des Bundes, Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen3 und gemeinnützige Organisationen.
Forschungseinrichtungen, die von Bund und/oder Ländern grundfinanziert werden, kann neben ihrer institutionellen Förderung nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Projektförderung für ihre zusätzlichen projektbedingten Aus gaben beziehungsweise Kosten bewilligt werden.
Besondere Zuwendungsvoraussetzungen
Die Projekte dürfen noch nicht begonnen haben. Als Projektbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines dem Projekt zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu werten. Planung, Genehmigungsverfahren etc. gelten nicht als Beginn des Projekts.
Die Erstnutzung von Ergebnissen der geförderten Projekte darf nur in Deutschland oder im Europäischen Wirtschafts raum (EWR) und der Schweiz erfolgen. Ausnahmen sind nur im Einzelfall möglich und bei Antragstellung gesondert zu begründen.
Gefördert werden meist von Unternehmen geführte Verbundprojekte mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung. Die Zusammenarbeit ist in einer Kooperationsvereinbarung zu regeln. Fremdleistungen dürfen 50 % der eigenen Projektkosten nicht überschreiten. Auch internationale Partner können beteiligt sein, erhalten jedoch keine Bundesmittel. Antragsteller müssen fachlich und finanziell geeignet sein. Besonders KMU sollen stark eingebunden werden
Art und Umfang, Höhe der Zuwendungen
Finanzierungsart
Die Zuwendung wird in der Regel in Form einer Anteilfinanzierung gewährt.
Im Fall der Förderung von Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen im Bereich ihrer nichtwirt schaftlichen Tätigkeiten ist ausnahmsweise eine Vollfinanzierung möglich (vgl. Verwaltungsvorschrift Nummer 2.4 zu§ 44 BHO).
Finanzierungsform
Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt.
Bemessungsgrundlage
Für die Festlegung der beihilfefähigen Ausgaben/Kosten und die Bemessung der jeweiligen Beihilfeintensität sowie der Beihilfeobergrenzen gelten je nach Fördergrundlage die jeweiligen Regelungen der Artikel 4, 25, 26, 27, 28 und 29 AGVO. Entsprechend dieser Bestimmungen ergeben sich folgende Förderquoten:
• für Grundlagenforschung bis zu 100 %,
• für industrielle Forschung bis zu 80 % für kleine Unternehmen, bis zu 75 % für mittlere Unternehmen sowie bis zu 65 % für große Unternehmen und
• für Experimentelle Entwicklung bis zu 60 % für kleine Unternehmen, bis zu 50 % für mittlere Unternehmen sowie bis zu 40 % für große Unternehmen
Die Laufzeit der Projekte soll im Regelfall drei Jahre nicht überschreiten. Es sind Ausnahmeregelungen möglich.
Antragsverfahren
Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.